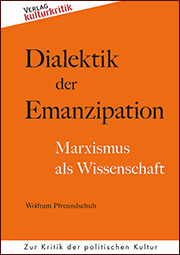Eine Einführung zur Erscheinung des Buches und Ibooks, ISBN: 978-3-947823-00-0, Januar 2019 (Verlag Kulturkritik):
==> Titel und Inhaltsverzeichnis als PDF laden <==
�berblick und Leseprobe (erscheint im Januar 2019 im Verlag Kulturkritik)
Dialektik der Emanzipation – Marxismus als Wissenschaft
Zur Einführung
„Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst.
Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andrerseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person.
Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine eigenen Kräfte als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“ (Karl Marx, Marx-Engels-Werke Bd.1, S. 370)
Waren das nur fromme Vorstellungen und Wünsche? Haben die bisherigen Realisierungen sozialistischer Ansprüche nicht in einer geradezu absoluten historischen Dimension erwiesen, dass sie lediglich Dogmen sind, welche die Menschen umso totaler in ein politisches System zwingen, wenn sie daran glauben, und sich widerstandslos in einen politischen Totalitarismus fügen, der genau das Gegenteil von dem betreibt, was er verspricht?
Tatsächlich haben sozialistische Umstürze bisher vor allem nur in ihren Anfangsstadien den Menschen eine Befreiung durch wirtschaftliche Fortschritte als „nachholende Modernisierung“ verschafft, und sind im Anschluss daran der Konkurrenz auf den Weltmärkten erlegen, in die sie damit eingetreten waren. Marxismus war als Theorie der Emanzipation entstanden und droht immer wieder als Machtpolitik seiner Ideale zu verkümmern, weil und solange er nicht wirklich und praktisch die politischen Kämpfe und Auseinandersetzungen der Menschen konkret auf das zurückführt, was sie praktisch auch wirklich sind. Als Gedanke drängen Ideen immer schon zu ihrer Verwirklichung, können aber nur sich selbst idealisieren, wenn sie ihre Gründe nicht erkennen und sich auch wirklich dort aufheben, sich dort verwirklichen, wo sie entstehen. Sie sind Zurückführung auf ihr wesentliches Verhältnis, um darin sich auch von sich selbst zu befreien, um dem denkenden Menschen die Geschichte zu eröffnen, die allen Menschen möglich ist, wenn sie in der Lage sind, die herrschenden Formationen durch den Sinn zu überwinden, den sie darin für sich gebildet haben und der selbst schon sich gegen den Anachronismus der gesellschaftlichen Formbestimmungen verhält, nach seiner Emanzipation verlangt.
„Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst.“ (Karl Marx, Marx-Engels-Werke Bd.1, S. 370)
Emanzipation (lat. „e manu cipere“) meint wörtlich: Sich aus der Hand anderer, also aus fremder Hand herausnehmen. Es ist ein Begriff für die Befreiung aus Fremdherrschaft und Entfremdung, für die Befreiung der menschlichen Wesenskräfte, die durch Ausbeutung beherrscht und enteignet existieren müssen. Nicht eine politische Kraft gegen herrschende Formen kann sich emanzipieren, sich zu eigen sein oder werden; es ist die Erkenntnis der eigenen Kraft als gesellschaftliche Kraft, die in der Emanzipation zu sich findet. Es ist also nicht die politische Form eines Widerstands, die durch Machtergreifung zur Macht kommen soll; es ist die Kraft der Subversion, die Kraft der Umkehrung verkehrter Verhältnisse, der gesellschaftlichen Formbestimmungen, die durch ihren gesellschaftlichen Inhalt in den Lebensverhältnissen der Menschen aufgehoben werden,um in der wahren Form ihrer Lebensäußerung, ihrer Vergegenständlichung, ihrer gesellschaftlichen Gegenständlichkeit aufgehen zu können, der Form, die ihrer Natur, der wirklichen Substanz ihres Wesens entspricht..
Emanzipation ist daher ein gesellschaftliches Verhalten in einem gesellschaftlichen Verhältnis, nicht einfach die Form einer Selbstverwirklichung, kein Bedürfnis, keine persönliche Eigenschaft eines bloßen Bestrebens, sondern die Notwendigkeit einer beherrschten Subjektivität, die Verhältnisse zu stürzen, in denen dem Menschen ein verächtliches Leben zugemutet wird, dass sie in der Verachtung ihres Lebens existieren müssen, keine gesellschaftliche Selbstachtung finden können, sich in ihren gesellschaftlichen Beziehungen selbst auch verächtlich empfinden, weil sie sich darin längst fremd geworden sind und einander fremd begegnen.
Die politischen Ziele und Versprechungen der Grundrechte einer „freien Persönlichkeit“ haben die Entwicklung der Produktivkräfte durch die Ausweitung der Märkte gefördert und die Menschen zu mündigen Bürgern im Sinne Immanuel Kants, zu politischen Subjekten und Repräsentanten der gesellschaftlichen Notwendigkeiten gemacht. Aber gerade hierdurch sind sie den herrschenden Notwendigkeiten unterworfen, indem sie politisch dem folgen müssen, was ihre Selbstentfremdung vertieft. Mit der Teilhabe an politischer Repräsentation reduzieren sie sich selbst zum Träger einer gesellschaftlichen Moral, die jedem Menschen zumutet, zu sein und zu tun, was gesellschaftlich nötig ist, um die Strukturen zu erhalten, die ihnen als Ordnung der Wesensnot eines überhistorischen gesellschaftlichen Subjekts auferlegt sind.
„Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andrerseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person.“ (Karl Marx, Marx-Engels-Werke Bd.1, S. 370)
Politik reduziert die Menschen auf den Willen, den sie in ihren staatsbürgerliche Positionen einnehmen können und der sich aus dem Meinen und Dafürhalten aus den Lebensperspektiven ihres gesellschaftlich bestimmten Daseins ergibt. Sie können darin den Lebensinhalten nachgehen, mit denen sie sich unter der Formbestimmung ihrer Verhältnisse versammeln können. Politik will Einfluss nehmen auf die Lebensbedingungen der Menschen, mit der Durchsetzung von Forderungen und Zielen im Ganzen ihrer Lebensverhältnisse leben gestalten und verändern. Politisch ist daher immer ein Verhalten, Bewusstsein und Denken, das sich auf ein politisches Gemeinwesen, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse im Ganzen bezieht, auf ein durch politische Grenzen umschriebenes Gemeinwesen, um darin in einer bestimmten Absicht oder mit einem bestimmten Willen oder mit einer bestimmten Einsicht mit politischer Macht einzugreifen. In diesem Sinn will Politik Zukunft gestalten und verwirklicht sich durch die Entscheidungen, wie sie in demokratischen Verhältnissen im Sinne der Menschen für nötig befunden werden. Das setzt deren Auseinandersetzung voraus über die Scheidung von Notwendigkeit und Freiheit des Entscheidens, der entschiedenen politischen Haltung als beschlossener, also entschlossener politischer Wille, der sich auf die Sache der Menschen bezieht, weil und sofern hierüber die Notwendigkeiten ihres Daseins begriffen sind und in der Freiheit ihrer Entscheidung die Emanzipation aus fremder Bestimmtheit, aus ihrer Entfremdung von sich, von ihrer Tätigkeit und ihrer Gesellschaft gesucht wird. Dies setzt aber voraus, dass die Menschen sich in einer fremden Gesellschaft gesellschaftlich erkennen können, dass ihnen ihr individuelles Dasein als gesellschaftliches Sein bewusst wird. Denn:
„Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine eigenen Kräfte als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“ (Karl Marx, Marx-Engels-Werke Bd.1, S. 370)
In der bürgerlichen Gesellschaft versteht sich Politik in der Form einer repräsentativen Demokratie als Verhalten eines allgemeinen persönlichen Gewissens zu bestimmten Ereignissen, für oder gegen diese die Meinung einer Mehrheit von Repräsentanten steht, die politisches Handeln einfordern. Politik soll hier also im Willen von Persönlichkeiten verkörpert sein, die als Repräsentanten einer Ansammlung von Meinungen diese als politischen Willen der vorherrschenden Wählermeinungen vertreten, aus denen sich der bürgerliche Staat konstituiert. Von daher bezieht sich Politik unter kapitalistischen Bedingungen auf das, was die Menschen im Allgemeinen als ihr Meiniges, als ihr Privateigentum verstehen, auf das persönliche Privatrecht der Warenbesitzer.
Durch das Privatrecht ist Politik notwendig von ihrer gesellschaftlichen Grundlage getrennt und in ihren Entscheidungen widersprüchlich zwischen dem, was sie wirklich scheiden und entscheiden kann und dem, was über sie schon durch ihre ökonomischen Bedingungen entschieden ist. Solange Politik nicht selbst wirtschaftlich ist und die wirkliche Lebensproduktion der Menschen in ihrem wirklichen Lebenszusammenhang entscheidet, bleibt sie eine Illusion des guten Willens, der die Wirkungen seiner Ent-Scheidungen und Getrenntheiten nicht mehr erkennen kann, verbleibt ihre Meinung als Ideologie eines guten Willens, der seine Kraft aus den Nebelbildungen ihrer Ideale beziehen soll, der also als moralischer Wille, als Ideologie allgemein herrschen soll, um den Individuen einen allgemeinen Willen als das Sollen einer Gemeinschaft, als ihr Gemeinwohl zu vermitteln.
“Es ist die alte Illusion, dass es nur vom guten Willen der Leute abhängt, die bestehenden Verhältnisse zu ändern ... Die Veränderung des Bewusstseins, abgetrennt von den Verhältnissen, wie sie von den Philosophen als Beruf, d. h. als Geschäft, betrieben wird, ist selbst ein Produkt der bestehenden Verhältnisse und gehört mit zu ihnen. Diese ideelle Erhebung über die Welt ist der ideologische Ausdruck der Ohnmacht der Philosophen gegenüber der Welt.” (Karl Marx, Marx-Engels-Werke 3, Seite 363)
Es war das einschneidende Resultat einer Epoche der so genannten Aufklärung, der einen kategorischen Imperativ eines allgemeinen Willen zum Instrument einer gesellschaftlichen Vernunft erheben wollte, mit der sich die allgemeine Verständigung als vergesellschafteter Verstand durch den Gemeinwillen einer gesellschaftlichen Vorstellung der Menschen sich auch politisch durchzusetzen hätte. Dies war dann auch in der bisherigen Geschichte tatsächlich der Ursprung einer Gesinnung, die nur noch auf die Bereinigung der sozialen Missstände durch die Missstände selbst zu einer Politik des Heils und seiner Endlösung geführt hatte.
“Je ausgebildeter und allgemeiner der politische Verstand eines Volkes ist, um so mehr verschwendet das Proletariat - wenigstens im Beginn der Bewegung - seine Kräfte an unverständige, nutzlose und in Blut erstickte Erneu[erungen]. Weil es in der Form der Politik denkt, erblickt es den Grund aller Übelstände im Willen und alle Mittel zur Abhülfe in der Gewalt und dem Umsturz einer bestimmten Staatsform.” (Karl Marx, Marx-Engels-Werke 1, 407)
Der politische Kampf um politische Ideale
Die politischen Vorstellungen bleiben bloße Ideologie, wenn sie sich unmittelbar gesellschaftlich zu ermächtigen suchen und von daher auch nur eine politische Machtfrage darstellen können, die letztlich auch nur die Macht einer Gesinnung sein kann, die nur mit einer politischen Gewalt durchzusetzen ist. Und das kann nur eine staatliche Formation mit den Waffen der Politik erbringen. Der Kampf um die Aneignung und Einvernahme einer Staatsmaschinerie (Lenin) hat inzwischen ein ungeheures Elend durch politische Machtkämpfe und deren Zerstörungswut gebracht. Sie wurden und werden auf der einen Seite durch die gesellschaftlichen Krisen des Kapitalismus, durch die Not der sozialen Verwerfungen befeuert, die aus den politischen Widersprüchen der wirtschaftlichen Verwertung der gesellschaftlichen Produktion hervorgehen. Auf der anderen Seite muss ihnen auch ein gesellschaftlich notwendiger Sinn, eine zündende Idee ihrer Perspektiven gegeben werden, die sich aus den Sinnstiftungen eines abstrakten Verstandes, auf seinen Gedankenabstraktionen beifügen lassen. Dazu dienen „ewige Wahrheiten“, die hohe Werte vermitteln und als Lebenswerte der Kultur durch Täuschung über die wirklichen Lebenszusammenhänge der Menschen auch unmittelbare politische Potenziale der politischen Macht entfachen. Es liegt an den Wissenschaften, diese zu destabilisieren, die Abstraktionen ihrer so genannten Objektivität zu begreifen und mit Erkenntnissen zu konfrontieren, welche die Menschen tagtäglich in ihrer Lebenspraxis subjektiv machen. Erkenntnis kann nur einen subjektiven Grund haben und kann diesen auch nur in die Objektivität der Lebensverhältnisse vermitteln, indem sie die Abstraktionen konkret aufklärt, die dort als Realabstraktionen funktionieren.
Es geht dann um deren Kritik. Aber die Aussage einer Erkenntnis wird äußerst kompliziert, sobald sie ihre subjektive Wahrheit als objektive beansprucht. Was ihr subjektiv als Erkenntnis in eigener Gewissheit vorausgesetzt ist, lässt sich objektiv nur über die Zusammenhänge ihrer Beweisführung, durch die Konsistenz ihrer Aussagen bewahrheiten, die notwendige Erkenntnis beinhalten. Denn Wahrheit ist keine schlichte Tatsache und auch nicht die objektive Schlüssigkeit einer Spekulation, sondern das Selbstbewusstsein des menschlichen Lebens. Und hierüber gibt es bereits einen Jahrtausende alten Streit, der in der Philosophie und Theologie wissenschaftlich ausgetragen und als Grundlage eines allgemeinen Humanismus zusammengeführt wurde. Doch in Europa war dieser so abstrakt geblieben, dass er einer Beweisführung nur schwer dienen konnte und seinen Kern nicht allzu weit über seine Ursprünge in der griechischen Philosophie bis in unsere Zeit tragen konnte. Die Wissenschaften blieben daher in ihrem hermeneutischen Zirkel hängen.
Der subjektive Gehalt einer menschlichen Erkenntnis war ob der Schwierigkeit ihrer Beweisführung weitgehend verdrängt worden. Die Wahrheitsfrage der Wissenschaften wird inzwischen nur noch mit bloßer Faktizität beantwortet, auf ihre funktionelle Wirkung reduziert. Hierfür hat der postmoderne Positivismus, der Strukturalismus die Beweislage der wissenschaftlichen Erkenntnis mit Statements überflutet, die aus den Selbstverständlichkeiten ihrer Funktion durch erklärt gelten sollte, was hierfür notwendig war. Und das war das, was das System für seine Funktionalität nötig hatte und das sollte durch die Optimierung ihrer Passgenauigkeit stabilisiert werden. Doch die Postmoderne wollte zugleich liberal sein. Sie war schließlich als Ideologie der Neoliberalen mit der Globalisierung des Kapitals entstanden. Und damit wollten und konnten die modernen Kulturbürger durch ihren pervertierten Hedonismus wieder mal Urständ feiern.
Und so wollte die Postmoderne mit der menschlichen Geschichte nicht nur kulturell, sondern auch wissenschaftstheoretisch an ihrem Ende angekommen zu sein. Das passte schließlich in die Zeit, bzw. die Zeitenwende von der Systemkonkurrenz der Weltanschauungen zur Weltherrschaft des fiktiven Kapitals (1). Doch immerhin war mit den Feuerbachthesen von Karl Marx doch zumindest der radikale humanistische Anspruch der Philosophie erhalten geblieben, die Blüten ihrer Ideologien zu beschränken. Der geschichtsbildende Mensch, das Subjekt der menschlichen Geschichte war damit noch darstellbar geblieben, auch wenn die bürgerlichen Wissenschaften sich durch den strukturellen Objektivismus ihrer Ideologien darüber épistémologisch, also erkenntnistheoretisch längst überhoben haben und zum Teil der Probleme geworden waren, die zu lösen sie vorgaben.
Jede Ideologie ist die Logik einer politischen Idee, die ihren Grund im Unvermögen ihrer Wirklichkeit hat, die also deren Mängel ideell aufzuheben trachtet und zugleich negativ hiergegen bestimmt ist. Von daher formuliert sie ein selbständiges Ziel, einen verselbständigten Gedanken, durch den sie sich ihrem Sein zu entziehen sucht (2). Die Kritik der Philosophie ist daher in ihrer Konsequenz Ideologiekritik, die derlei Ideen politisch nur aufheben kann, wenn sie die Bedingungen ihres Daseins analysiert und deshalb in deren Erklärung aufgeht, ihren politischen Gehalt aus der Seinsnotwendigkeit wirklicher - und also wirksamer - Mängel zu erklären in der Lage ist. Und hierfür müssen aus ihren bloßen Gedankenabstraktionen ein Sinnzusammenhang der Realabstraktion und deren Formbestimmungen als Grundlage der Ideologie im Verhältnis zu ihrer Wirklichkeit aufgedeckt werden.
Ohne sich aus dem wesentlichen des menschlichen Lebens zu begründen, ohne seine Wesensnot zu erkennen, bleibt jede Wissenschaft eine schale Selbstbestätigung ihrer Ideologie. Dass die Geschichte der menschlichen Gesellschaften selbst ihrer Notwendigkeiten folgen musste und in ihren Epochen durch deren Emanzipation überwunden wurde, war als historischer Materialismus zur Grundlage des Marxismus geworden. Immer wieder tot geglaubt hat er inzwischen über 170 Jahre seit der Verfassung des Kommunistischen Manifestes überdauert. Keine manifeste Revolution kam ohne Marx aus, keine Krisentheorie des Kapitalismus kam an ihm vorbei.
Marxistische Theorie war aber niemals nur eine Anleitung zu einem politischen Handeln, wodurch sich eine unterdrückte Klasse der Gesellschaft stellvertretend für die ganze Menschheit als ein gesellschaftliches Subjekt der Zukunft verhalten könne, sich nur gegen die herrschende Klassen aufrichten müsse, um sich und damit zugleich die ganze Gesellschaft aus der Not ihrer Eigentumslosigkeit zu emanzipieren. Auch kann keine Kritik ihrer Ideen, keine Gleichschaltung der Menschen und kein Staat sie befreien. Ideologiekritik war selbst zur Ideologie geworden, Klassenkämpfe zum bloßen Selbstzweck einer neuen Herrschaftsformation. Die Reduktion auf einen rein politischen Willen hatte immer gerade ihr Gegenteil bewirkt und ihre Kritik zum Mittel einer verheerenden Anpassung, zum Rückfall in eine andere Art der Barbarei werden lassen.
Hierfür wäre kein umfassender theoretischer Aufwand nötig gewesen, keine weitgehende Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Widerstand gegen den Kapitalismus als gesellschaftliche Notwendigkeit der Selbstveränderung des Menschen in ihrer Substanz belegen kann und dem platten Antikapitalismus den politischen Mythos, den Heldenepos eines gesellschaftlichen Subjekts, eines massenhaften Aufstands der Bedrängten und Heimatlosen, als Genugtuung eines vergemeinschafteten Volkes entziehen konnte. Marxismus besteht nicht aus einer bloßen Parteinahme und kann kein Parteiprogramm begründen und keine allseitige Gleichheit und Gerechtigkeit auf Erden versprechen, keine Religion ersetzen und kein Glück einer Menschheit im ewigen Frieden durch bloße Meinungsäußerung und allgemeiner Vorstellung zusichern. Aber er konnte die menschliche Gesellschaft zum Brennpunkt der Fragen über die Lebensverhältnisse der Menschen bringen, wenn ihre gesellschaftlichen Beziehungen auf sie als eine fremde Macht zurückkommen, wenn ihre eigenen Lebensäußerungen ihnen entäußert sind, sich als Formbestimmung ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse selbständig gegen sie verhalten, wenn sie sich in der Wirklichkeit ihres Lebens fremd gegenüber stehen, weil sie sich im Allgemeinen nur privat, nicht wirklich gesellschaftlich beziehen können und sie ihr Gemeinwesen als Entfremdung des Menschen vom Menschen, von seiner Arbeit, seiner Gesellschaft und seiner Gattung erleiden müssen
„Der Mensch verliert sich nur dann nicht in seinem Gegenstand, wenn dieser ihm als menschlicher Gegenstand oder gegenständlicher Mensch wird. Dies ist nur möglich, indem er ihm als gesellschaftlicher Gegenstand und er selbst sich als gesellschaftliches Wesen, wie die Gesellschaft als Wesen für ihn in diesem Gegenstand wird.“ (Marx-Engels-Werke Bd.40, S. 24).
Vom Wesen der Entfremdung
Ein gesellschaftliches Wesen kann nicht ein bloßes Ideal sein. Es ist immer schon durch das geschichtliche Dasein der menschlichen Gesellschaft geworden, wie sie immer das Verhältnis einer allgemeinen Lebensäußerung der Menschen ist und als diese auch wieder verwesen, in andere Gestaltungen übergehen kann. Und weil Menschen sowohl natürlich sind und zugleich ihrer Natur mit Macht begegnen, stellt sich in der Gestaltung ihrer Lebensäußerungen immer schon die Natur ihrer Naturmächtigkeit dar, das geschichtliche Verhältnis der Menschen zu sich und zu ihrer Natur, ihrer Intelligenz und ihrem Stoffwechsel, wie sie sich diese angeeignet und sich hieraus fortgebildet haben, was ihre Geschichte vorangetrieben und was sie behindert hat. Wesentlich sind es eben die Menschen, die ihre Gesellschaft bilden und nicht die Gesellschaft, welche ihre eigene Geschichte macht (3), indem sie die Menschen bestimmt, weil sie hierzu geschichtlich determiniert wäre und von daher das Leben der Menschen bestimmen müsse. Keine Determinante und keine Seinslogik, keine Ontologie kann Geschichte bestimmen, bevor sie sich im gesellschaftlichen Verhältnis der Menschen entwickelt. In ihrer Wirklichkeit als lebendiges Verhältnis der Menschen zu ihrer Natur bildet sie sich und kann im Nachhinein in diesem Verhältnis begriffen werden.
Der allgemeine Begriff der Entfremdung beschreibt daher nicht eine Entäußerung des menschlichen Lebens schlechthin (wie bei Hegel), sondern eine geschichtliche Deformation, eine gesellschaftliche Beziehung der Menschen, in der sie in der Lebenswirklichkeit ihrer Verhältnisse von sich absehen müssen, sich selbst fremd werden, um sich darin aufeinander überhaupt zu beziehen, ihre Lebensäußerungen ihnen äußerlich, entäußert erscheinen, weil darin ihr gesellschaftliches Wesen entäußert, ihre Wesensnot entstanden ist. Der Begriff der Entfremdung ist daher politisch und kommt in linken wie auch rechten Positionen zum Tragen, wo er sich als politischer Wille darstellt, der ihre „wahren Verhältnisse“ herstellen soll und sich damit auf eine Täuschung über das Wesen des Menschseins bezieht. Doch dieses Wesen gibt es nur in seiner praktischen, in seiner materiellen Wirklichkeit und kann darin nicht einfach objektiv, objektive Form sein.
„Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus - den Feuerbachschen mit eingerechnet - ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als menschliche sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv.“ (1. Feuerbachthese, MEW Bd.3, S. 533).
Jeder politische Wille ist daher lediglich eine politische Idee, durch welche eine objektive Welt verändert werden soll. Und solche Idee bezieht ihre Macht aus Gedanken und Vorstellungen, die einen Mangel formulieren, der den Verhältnissen wie den Menschen einfach nur vorgeworfen wird und eine Verwirklichung ihrer Idee zur Behebung der darin formulierten und zugleich aufgehobenen Mangelerscheinung ausdrückt. Ihre Ideologie repräsentiert sich daher auch in einem krassen Gegensatz zwischen objektiver Macht und subjektiver Ohnmacht, die sich in den Strategien der Überwältigung oder der Emanzipation unterscheiden.
Während eine Emanzipation der Menschen aus der Entfremdung ihrer Natur abgeleitet und auf ihre gesellschaftliche Natur als gesellschaftliche Geschichte des menschlichen Lebens gerichtet ist (Karl Marx), wird Entfremdung von den Existenzialisten als eine Täuschung über die Eigentlichkeit der Erfahrbarkeit ihres Lebens in ihrem Erleben verstanden, die durch die tierischen Begierden unvollkommener Menschen entstellt (Friedrich Nietzsche) und in den Ereignissen der Weltgeschichte „vergessen“ wird (Martin Heidegger). Entfremdung ist subjektiv versanden das gerade Gegenteil von einer Emanzipation, die sie objektiv begriffen haben will.
Begrifflich steht dies beides aber durchaus im selben Brennpunkt einer Beschreibung, die fremde Mächte darstellt, die politisch bekämpft werden sollen. Es geht dem hierauf gegründeten politischen Willen allerdings um ein Unwesen, um ein Wesen, das entweder durch eine Seinsvergessenheit oberflächlicher Menschen untergegangen oder durch einen Verblendungszusammenhang der Kulturindustrie missbraucht sein soll. In dieser Einfachheit lässt sich ein solcher Begriff der Entfremdung ja auch ziemlich beliebig auf alles beziehen, was dem einzelnen Menschen fremd erscheinen kann, was ihm falsch oder unnatürlich vorkommt, ihm unartig, abartig oder wesensfremd, als eine fremde Lebensart erscheint. Von daher bietet die Phänomenologie ein weites Feld der Mutmaßungen über das Wesen des Lebens. In den Phänomenen mag darin auch vieles als dasselbe erscheinen, was wesentlich sehr verschieden, im Grunde in einer vernichtenden Gegensätzlichkeit existiert. Und das wäre auch offen und leicht erkennbar als das Dilemma der Vernunft solchen Denkens, wäre nicht gerade dieses selbst ausgesprochen dienstbar für die Austauschbarkeit von Wesen und Erscheinung und damit von Begründungen, die es zugleich an jeder Stelle zu beklagen weiß.
Wenn ein Wesen unbegriffen und deshalb nur abstrakt aufgegriffen wird, so wird in solcher Unterschiedslosigkeit das Phänomen selbst zu einer Abstraktion. Es kann dann nicht erkannt werden, was seine verborgene Wirkung ausmacht, weil seine Erscheinung selbst begrifflich verborgen, deren konkretes Sein selbst abstrakt „verwesentlicht“ wird. Dadurch lassen sich nicht mehr die abstrakten Zusammenhänge seiner Abwesenheit erschließen, weil sie als eine Zumutung der Wahrnehmung, als deren Täuschung verbleiben. Und weil darin alles „täuschend echt“ wird, lässt es sich mit allem auch leicht versöhnen. Dies war immer schon das Fiasko der Theoriebildung (1).
Für die Phänomenologie ist deshalb jede Entfremdung eben auch nur etwas Falsches, die Abweichung von der guten Form, die sie wissenschaftlich aus einer “eidetischen Reduktion” auf ihren eigentümlichen Inhalt als Wesen ihrer Eigentlichkeit bezogen haben will. Hier wird Entfremdung aus dem “Uneigentlichen” der Lebensgestaltung als einfache Negation ihrer Eigentlichkeit auf diese bezogen. Dagegen ist für den Marxismus Entfremdung die Verkehrung der Natur eines Gemeinwesens, der Natur des gesellschaftliches Subjekts der Geschichte, die sie verkehrt sein lässt. Während deren Widersprüche ihrer gesellschaftlichen Form mit deren Formbestimmung aufgehoben werden müssen, will die Phänomenologie das Fehlverhalten von geschichtlichen Persönlichkeiten, das persönliche Wesen ihrer Verfehlungen ausschalten.
Die Immanenz und die Transzendenz steht mit dem Begriff der Entfremdung zur Disposition, die Frage, was denn überhaupt wesentlich ist: der einzelne Mensch oder der gemeine Mensch, die Form oder der Inhalt gesellschaftlicher Verhältnisse, ihre Produktion oder das Leben darin? In der phänomenologischen Begrifflichkeit kulminiert das unaufgelöste Problem der Aufklärung, der Proklamation des selbstbewussten Bürgers, der sich einerseits in einer vernünftigen Form gesellschaftlich objektivieren soll, und der andererseits von einer gesellschaftlichen Macht gegen sich selbst bestimmt ist, von daher keine natürliche Form für sich finden kann. Was die bürgerlichen Wissenschaften als objektive Vernunft eines instrumentellen Verhaltens zur Problemlösung in gesellschaftlichen Widersprüchen und Gegensätzen vorbringen und unterstützen wollen, macht jede Subjektivität unfassbar, weil sie diese unbeschränkt objektiviert und sie als objektiv Vernunft gegen sich selbst richtet und instrumentalisiert. Instrumentelle Vernunft verwandelt gesellschaftliche Widersprüche in Selbstentfremdung und lässt die Menschen ganz allgemein isoliert und sich selbst fremd zurück. Und deshalb kann auf eine Auseinandersetzung mit dem Entfremdungsbegriff nicht verzichtet werden. Er steht für beides, für menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Formen. Man muss ihn also bis zur sinnlichen Gewissheit seiner Begründung diskutieren und die Moral eines bloß vernünftigen Instrumentariums kategorischer Imperative als Herrschaftsmittel kenntlich machen.
Die platten Schlussfolgerungen der Phänomenologie haben aber auch schon ohne dies die Welt der Gedankenabstraktionen erobert. Aus ihren Assoziationen der Semiotik des Gemüts (5) lassen sich leicht individuelle Eigenheiten verallgemeinern und als Voraussetzung eines überindividuellen Systems verstehen, das die Welt im Großen und Ganzen vor jeder Erfahrung schon bestimmt. Die Kinder der Phänomenologie, die Strukturalisten gehen deshalb davon aus, dass es regulierende, allgemeingültige, präindividuelle Strukturen gibt, die unabhängig von den Menschen eine natürliche Notwendigkeit verfolgen, ohne dass sie dies wissen. Ein Individuum sei daher in seinem „Gestaltungswillen“ immer vom „Beziehungsgefüge“ der Strukturen seines Lebens bestimmt, die gut oder auch schlecht für die Menschen sein können. Von daher sei Wissenschaft gefordert, die Strukturen, Ordnungen und Funktionen, wie sie sich aus ihrer Empathie für das Ganze einer Gesellschaftsformation ergeben, zu beurteilen und entsprechend zu behandeln. Deren “Richtigkeit” bzw. Falschheit ließe sich letztlich immerhin schon aus den natürlichen Ursprüngen ihrer Systematik, aus deren quasi naturwissenschaftlichen Ontologie heraus als Lebenswissenschaft ableiten und in der Gegenwart belegen und durch angemessene Eingriffe in ihre Funktionalität korrigieren (6).
1) Die Postmoderne bricht mit dem elitären Kunst- und Wissensverständnis des Modernismus und geht damit indirekt auf die Philosophie Friedrich Nietzsches und die Existenzphilosophie Martin Heideggers zurück: Da die Welt nicht vollends erfasst und erklärt werden könne, sei “das Gebälk der Begriffe” (Nietzsche) überkommen und “die Frage nach dem Sinn des Seins” (Heidegger) nur durch Annäherung an ihre “Existenzialien” zu erkunden. Was wie ein strenger Gedanke daherkommt, steht allerdings für eine umfassende Relativierung des Denkens überhaupt und hat es auf eine Pluralisierung von Denkstilen und Formen reduziert, die ihre “Wahrheit” schon alleine durch ihre praktische Wirkung durch deren Funktionieren belegen könnten. Die bloße Existenz ist für den Existenzialismus von selbst schon das Seiende und das allein Notwendige schlechthin. Deren Geschichte würde sich daher auch nicht aus und in größeren Zusammenhängen ergeben sondern eben durch sich und für sich selbst wie in einer Erzählung ereignen. Weder eine umfassende Totalität oder Vernunft noch ein fester Sinnhorizont bei der Weltdeutung sei daher nötig. Die Geschichte wäre nicht mehr als hinreifender Entwicklungsprozess aus gesellschaftlichen Auseinandersetzungen (vergl. Historischer Materialismus) zu verstehen, sondern als regellose Abfolge verschiedenartiger Ereignisse, die auch mehr oder weniger sinnvoll durch individuelle oder gemeinschaftliche kulturelle Einwirkungen von Menschen als Persönlichkeiten ihres Tuns und Lassens betrieben werden könnte. Werbung, Mode und Massenmedien finden daher ebenso Eingang in postmoderne Ausdrucksformen wie multimediale Installationen oder Pop-Events einer Eventkultur, die somit Ausdruck ihrer allgemeinen Selbstverwirklichung sei.
2) Ideologie ist von daher ein bloß abstraktes Bewusstsein, das allein durch seine Sprache schon Wirklichkeit als eine Idee gedanklich in sich abschließt und in deren Wirkung theoretisch verdoppelt. Was die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse wirklich für die Menschen sind wird durch Gedankenabstraktionen verschlossen, die Einsicht in ihre Gründe ausgeschlossen und durch ihre Ausschließlichkeit gegen Kritik verwehrt.
3) „Die Geschichte tut nichts, sie besitzt keinen ungeheuren Reichtum, sie kämpft keine Kämpfe! Es ist vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige Mensch, der das alles tut, besitzt und kämpft; es ist nicht etwa die Geschichte, die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre - als ob sie eine aparte Person wäre - Zwecke durchzuarbeiten, sondern sie ist nichts als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen.” (MEW, Bd. 2, S. 98).
4) Dieses Fiasko hat sich in den jüngeren Entwicklungen zwischen Heidegger und Adorno zugetragen, die beide als Kulturkritiker essenziell aufgetreten sind und blindlings dasselbe verteidigt haben, was im Schein der Verhältnisse, im notwendigen Schein des Kapitals funktionell identisch ist. Dennoch ist es erstaunlich, dass gerade Adorno, dessen formuliertes Anliegen die Bekämpfung eines jeden Totalitarismus war, den totalitärsten Spruch ausgab, den man überhaupt machen kann und den eine radikale Rechte ebenso verstehen konnte wie eine radikale Linke, - nämlich, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ geben könne. Rein intellektuell ist es eben nicht selbstverständlich, dass ein Leben niemals falsch sein kann, sondern höchstens widersprüchlich ist. Mit seiner „negativen Dialektik“ geriet Adorno allerdings schon früh auf eine falsche Spur seiner Soziologie, die sich von Heidegger und dessen „Jargon der Eigentlichkeit“ (so Adornos Kritik) nur rein sprachlich unterscheiden konnte. Rein logisch bleibt sich eben im Eigentlichen alles gleich und lässt sich wie auch Ideologiekritik überhaupt immer substanziell auch in sein Gegenteil verkehren, wenn es sich der Analyse seiner Bezogenheiten entzieht. Der abgehobene Intellekt mag sich damit bestätigt sehen, indem er ein ihm völlig gleichgültiges fremdes Eigentum mit einer freiheitlichen Verständigkeit garniert, die sich allerdings den Notwendigkeiten des praktischen Lebens kritisch entzieht und sich ihm deshalb nicht zuwenden, sondern nur aufzwingen kann.
5) „Die Semiotik (auch: Semiologie) ist die Wissenschaft von den Zeichenprozessen in Kultur und Natur. Zeichen, wie zum Beispiel Bilder, Wörter, Gesten und Gerüche, vermitteln Informationen aller Art in Zeit und Raum. In Zeichenprozessen (Semiosen) werden Zeichen konstituiert, produziert, in Umlauf gebracht und rezipiert. Ohne Semiose wären Kognition, Kommunikation und kulturelle Bedeutungen nicht möglich.“ (http://www.semiotik.eu/Semiotik)
6) Strukturalistisches Arbeiten findet sich in der Ethnologie (Claude Levi-Strauss), der Narratologie (Vladimir Propp, Julien Greimas u. a.), in den Anfängen der Diskurstheorie (Michel Foucault – der Strukturalist gegen die pastorale Struktur der Institution), im Poststrukturalismus. Strukturalisten sind immer zugleich Semiotiker, die Bereiche Semiotik und Strukturalismus sind nur schwer voneinander zu trennen.